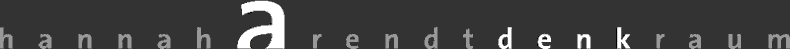
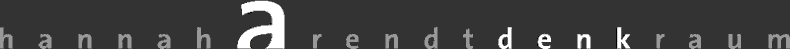 |
|
Text der Lesung mit Maren Kroymann und Sebastian Hefti Hannah Arendts Geburtstag: Ein Jahrhundert eines Denkraums Liebe Hannah! Es wäre schön, wenn Sie so disponierten, dass Sie eine Weile oben bei uns arbeiten würden, und wir in Ruhe unsere "Diskussionen" in den Zwischenstunden fortsetzen könnten. Seit Ihrer Abreise (...) und unseren damaligen Gesprächen (...) ist mir bewusst, dass wir uns vielleicht noch viel zu sagen haben. Es ist mir, als ob ein Widerstreit sich gezeigt hätte, der auf dem Boden unserer verlässlichen Solidarität nur um so wesentlicher und bewegender sein könnte. (...) Vielleicht bin auch schon zu alt, um mit Ihnen in die Haare geraten zu können. Dann wird es auf andere Weise schön. Sie bringen die Weite der Welt heute - und vor allem: Sie bringen, wovon gar nicht zu sprechen ist und nicht gesprochen werden kann, die menschliche Wirklichkeit, die Sie gemeinsam mit Ihrem Mann, in dieser Welt trotz dieser Welt, sich gebaut haben. (Basel, 15. Juli 1955, Karl Jaspers an Hannah Arendt) Liebe Hannah Sie wollen Ihren fünfzigsten Geburtstag nicht feiern. Aber er ist nun Wirklichkeit. Wenn ich an diesen Tag denke, bin ich dankbar und feierlich gestimmt. Denn Sie gehören zu den Menschen, die ich zu den großen Glücksfällen rechne. Was für ein Leben haben Sie geführt! Es ist Ihnen geschenkt und von Ihnen erworben in einer Standhaftigkeit, die des Unheils, dieses uns meist aufreibenden von außen kommenden Entsetzens, Herr wurde, und in einer wunderbaren Kraft nobler Antriebe, die noch Ihre Sie bedrohende Weichheit, noch Ihre gefährliche Unfestigkeit, noch Ihr "Vergaloppieren" verwandelte in Sinnmomente Ihres Wesens. Wohl gehört zu dieser Kraft auch Ihre Vitalität. Gesundheit ist etwas Herrliches, und Schönheit und das Gefallen der Menschen. Aber das war es nicht, was Sie wirklich getragen hat. Es wurde in Ihren Dienst gestellt. (Basel, 13. Oktober 1956, Karl Jaspers an Hannah Arendt) Lieber Verehrtester - Sie haben recht, ich habe mich gescheut, Geburtstag zu feiern, und dann kam ihr Brief und es war doch eine Feier. Was ich mir wirklich wünsche, wäre, einmal noch so zu sein, wie Sie meinen, dass ich bin. Wovor ich mich beim Fünfzigsten scheue, sind vielleicht die bevorstehenden vitalen Veränderungen, sicher aber die doch notwendig werdende "Würde", von der ich nun beim besten Willen nicht weiß, wie ich sie mir zulegen soll. Und lächerlich will man doch auch nicht gerne werden. Von Herzen Ihnen beiden - Ihre Hannah (Genf, 16. Oktober 1956, Hannah Arendt an Karl Jaspers) Hannah Arendt - die Tatsache, dass wir geboren werden Die Bedingungen, unter denen wir uns heute im politischen Feld bewegen, stehen unter der Bedrohung verwüstender Sandstürme. (...) Ihre Gefahr ist, dass sie die uns bekannte Welt, die überall an ein Ende geraten scheint, zu verwüsten droht, bevor wir Zeit gehabt haben, aus diesem Ende einen neuen Anfang erstehen zu sehen, der an sich in jedem Ende liegt, ja, der das eigentliche Versprechen des Endes an uns ist. "Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen", sagt Augustin. Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen. Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen. Aber wiewohl niemand sich diesem Minimum an Initiative ganz und gar entziehen kann, so wird sie doch nicht von irgendeiner Notwendigkeit erzwungen wie das Arbeiten, und sie wird auch nicht aus uns gleichsam hervorgelockt durch den Antrieb der Leistung und die Aussicht auf Nutzen. Die Anwesenheit von Anderen, denen wir uns zugesellen wollen, mag in jedem Einzelfall als ein Stimulans wirken, aber die Initiative selbst ist davon nicht bedingt; der Antrieb scheint vielmehr in dem Anfang selbst zu liegen, der mit unserer Geburt in die Welt kam, und dem wir dadurch entsprechen, dass wir selbst aus eigener Initiative etwas Neues anfangen. In diesem ursprünglichsten Sinne ist Handeln und etwas Neues Anfangen dasselbe; (...) Weil jeder Mensch auf Grund des Geborenseins ein initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. (...) Dieser Anfang, der der Mensch ist, insofern er Jemand ist, fällt keinesfalls mit der Erschaffung der Welt zusammen; das, was vor dem Menschen war, ist nicht Nichts, sondern Niemand; seine Erschaffung ist nicht der Beginn von etwas, das, ist es erst einmal erschaffen, in seinem Wesen da ist, sich entwickelt, andauert oder auch vergeht, sondern das Anfangen eines Wesens, das selbst im Besitz der Fähigkeit ist anzufangen: es ist der Anfang des Anfangs oder des Anfangens selbst. Mit der Erschaffung des Menschen erschien das Prinzip des Anfangs, das bei der Schöpfung der Welt noch gleichsam in der Hand Gottes und damit außerhalb der Welt verblieb, in der Welt selbst und wird ihr immanent bleiben, solange es Menschen gibt; was natürlich letztlich nichts anderes sagen will, als dass die Erschaffung des Menschen als eines jemands mit der Erschaffung der Freiheit zusammenfällt. (...) Der Neuanfang steht stets im Widerspruch zu statistisch erfassbaren Wahrscheinlichkeiten, er ist immer das unendlich Unwahrscheinliche; er mutet uns daher, wo wir ihm in lebendiger Erfahrung begegnen (...) immer wie ein Wunder an. Die Tatsache, dass der Mensch zum Handeln im Sinne des Neuanfangens begabt ist, kann daher nur heißen, das er sich aller Absehbarkeit und Berechenbarkeit entzieht, dass in diesem Fall das Unwahrscheinliche selbst noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, und dass das, was "rational", d.h. im Sinne des Berechenbaren, schlechterdings nicht zu erwarten steht, doch erhofft werden darf. Und diese Begabung für das schlechthin Unvorhersehbare wiederum beruht ausschließlich auf der Einzigartigkeit, durch die jeder von jedem, der war, ist oder sein wird, geschieden ist, wobei aber diese Einzigartigkeit nicht so sehr ein Tatbestand bestimmter Qualitäten ist oder der einzigartigen Zusammensetzung bereits bekannter Qualitäten in einem "Individuum" entspricht, sondern vielmehr auf dem alles menschliche Zusammensein begründenden Faktum der Natalität beruht, der Gebürtlichkeit, kraft derer jeder Mensch einmal als ein einzigartig Neues in der Welt erschienen ist. Der Denkraum Hannah Arendt (Mary McCarthy, 1972:) Dieser Raum, den Hannah Arendt in ihrem Werk schafft und in den man sich hineinbegeben kann - mit dem erhebenden Gefühl, das man hat, wenn man durch einen Bogen in ein befreites Gebiet geht! Und ein Grossteil davon wird von Definitionen besetzt! Sehr nahe an den Wurzeln von Hannah Arendts Denken befindet sich die "distinctio": Ich unterscheide dies von jenem. (...) Dies ist in Wahrheit eine mittelalterliche Denkungsart. Sie ist aristotelisch! Das Unterscheiden ist in der modernen Welt, wo über den meisten Diskussionen eine Art Wortnebel liegt, nicht weit verbreitet. (...) Ich würde sagen, dass jede dieser Unterscheidungen in diesem befreiten Gebiet, in diesem freien Raum wie ein kleines Haus dasteht. (...) Was sie über Unterscheidungen sagen, ist vollkommen richtig. Ich beginne immer alles - ich will nicht allzu genau wissen, was ich tue -, ich beginne also immer alles, indem ich sage: A und B sind nicht dasselbe. Hannah Arendt - ist sie links oder rechts, fortschrittlich oder konservativ? Sie fragen mich, wo ich stehe. Ich stehe nirgendwo. Ich schwimme wirklich nicht im Strom des gegenwärtigen oder irgendeines anderen politischen Denkens. Allerdings nicht deshalb, weil ich so besonders originell sein will - es hat sich vielmehr einfach so ergeben, dass ich nirgendwo so richtig hineinpasse. (...) Ich meine damit nicht, dass ich missverstanden werde. Im Gegenteil, ich werde sehr gut verstanden. Doch wenn Sie eine solche Sache aufbringen und den Leuten ihre Geländer, ihre sicheren Wegweiser nehmen (...), dann kommt es natürlich zu der Reaktion - und das ist mir sehr oft passiert -, dass man einfach ignoriert wird. Und das macht mir nichts aus. Manchmal wird man angegriffen. Aber gewöhnlich werde ich nicht beachtet, weil in meinem gedanklichen Horizont, nicht einmal eine nützliche Polemik ausgetragen werden kann. Und Sie können behaupten, dass dies eigentlich meine Schuld ist. Hannah Arendt - sie will verstehen Verstehen beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. In dem Ausmaße, in dem das Heraufkommen totalitärer Regime das Hauptereignis unserer Welt ist, heißt den Totalitarismus verstehen, nicht irgendetwas entschuldigen, sondern uns mit einer Welt, in welcher diese Dinge überhaupt möglich sind, versöhnen. Viele Wohlmeinende wollen diesen Prozess abkürzen, um andere zu erziehen und die öffentliche Meinung auf ein höheres Niveau zu heben. Bücher können Waffen sein, denken sie, und man könne mit Worten kämpfen. Waffen aber und das Kämpfen gehören zum Betätigungsfeld der Gewalt, und Gewalt ist im Unterschied zur Macht stumm; Gewalt beginnt, wo das Reden endet. Worte, die zum Zwecke des Kämpfens benutzt werden, verlieren ihre Redequalität; sie werden Klischees. Das Ausmaß, in dem sich Klischees in unsere gewöhnliche Sprache und alltäglichen Diskussionen eingeschlichen haben, mag sehr wohl anzeigen, bis zu welchem Grad wir uns nicht nur der Fähigkeit der Rede beraubt haben, sondern auch bereit sind, Gewaltmittel, die noch wirkungsvoller sind als schlechte Bücher (ohnehin können nur schlechte Bücher gute Waffen sein), zur Beilegung unserer Meinungsverschiedenheiten zu gebrauchen. (...) Auch wenn es keine sonderlich hilfreichen oder inspirierenden Ergebnisse zeitigen kann, muss Verstehen den Kampf gegen den Totalitarismus, so er mehr sein soll als ein reiner Überlebenskampf, begleiten. Insofern als totalitäre Bewegungen in der nicht-totalitären Welt entstanden sind, (... denn die totalitären Systeme wurden nicht vom Mond importiert) ist der Prozess des Verstehens, ganz klar, vielleicht sogar in erster Linie ein Prozess des Selbst-Verstehens. Denn wir wissen zwar, verstehen allerdings noch nicht, wogegen wir kämpfen, aber wir wissen sehr viel weniger, geschweige denn verstehen, wofür wir kämpfen. (Günther Gaus, 1964:) Wollen Sie mit Ihren Arbeiten eine Wirkung in der Breite erzielen? Wenn ich ganz ehrlich sprechen soll, dann muss ich sagen: Wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert. Und wenn die Arbeit fertig ist? Ja, dann bin damit fertig. Wissen Sie, wesentlich ist für mich: Ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist, nicht wahr, Teil in dem Verstehensprozess. (...) Weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. (...) Worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, es im Schreiben adäquat auszudrücken, bin auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie nach der Wirkung. Es ist das - wenn ich ironisch reden darf - eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken; aber ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirken? Nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen - im selben Sinne, wie ich verstanden habe -, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatgefühl. Hannah Arendt über die Liebe. Aus ihrem Denktagebuch Verstehen in der Politik heißt nie, den Anderen verstehen (nur die welt-lose Liebe "versteht" den Anderen), sondern die gemeinsame Welt so, wie sie dem Anderen erscheint. In der Liebe, nur in ihr, gibt es wirkliche Gegenseitigkeit, die auf dem Einander-Bedürfen beruht. Ein Mensch sein heißt, zugleich, eines (andern) Menschen bedürfen. Alles Reden mit Anderen ist immer schon Reden über etwas beiden Gemeinsames, also nicht Reden aus und in der Sache selbst. (...) Ohne die Form des ‚über' gibt es kein Gespräch. Im ‚über' drückt sich aus, dass wir zusammen die Erde bewohnen. Nur die Rede der Liebenden ist frei von diesem ‚über'; in ihr spricht man mit dem Du wie mit sich selbst, weil dies Du das Du nur eines Ichs ist. (...) Die Rede der Liebenden erlöst von beidem zugleich, von dem ‚über', in dem man die Welt mit Vielen (Fremden) gemeinsam hat, und von der Zwiespältigkeit der Einsamkeit. Die Rede der Liebenden ist daher von sich aus ‚poetisch'. (...) Es ist, als ob in ihr erst Menschen dazu werden, als was sie sich als Dichtende geben: Sie reden nicht, und sie sprechen nicht, sondern sie ertönen. Die Liebe verbrennt, durchschlägt wie der Blitz das Zwischen, das heißt den Welt-Raum, zwischen den Menschen. Dies ist nur möglich mit zwei Menschen. Tritt der Dritte hinzu, so stellt sich Raum sofort wieder her. Arbeiten - Denken - Lieben sind die drei Modi des schieren Lebens, aus denen nie eine Welt erstehen kann und die daher eigentlich welt-feindlich, anti-politisch sind. Das Herz ist ein komisches Organ; erst wenn es gebrochen ist, schlägt es seinen eigenen Ton; wenn es nicht bricht, versteinert es. Der Stein, der einem vom Herzen fällt, ist fast immer der, in welchen sich das Herz fast verwandelt hätte. Hannah Arendt denkt Es gibt keine gefährlichen Gedanken; das Denken selbst ist gefährlich. Wenn wir alles wissen würden, würden wir das Denken aufgeben. Hannah Arendt denkt politisch Politisches Denken ist das Einzige, was sich im "common sense" bewegen muss, also nicht nur in ihm gründet und dann in eine andere Dimension wächst. Es verbleibt ständig in der gemeinsamen Welt. Durch die Flucht aus der Politik verschleppen wir die Wüste überall hin - Religion, Philosophie, Kunst. Wir ruinieren die Oasen! Hannah Arendt kritisiert die Wissenschaft der Politik Es spricht, scheint mir, gegen den gegenwärtigen Stand der politischen Wissenschaft, dass unsere Fachsprache nicht unterscheidet zwischen Schlüsselbegriffen wie Macht, Stärke, Kraft, Autorität und schließlich Gewalt - die sich doch alle auf ganz bestimmte, durchaus verschiedene Phänomene beziehen und kaum existieren würden, wenn sie das nicht täten. (...) Sie synonym zu gebrauchen, zeigt nicht nur, dass man das, was die Sprache eigentlich sagt, nicht mehr hören kann, was schlimm genug wäre; der Unfähigkeit, Unterschiede zu hören, entspricht die Unfähigkeit, die Wirklichkeiten zu sehen und zu erfassen, auf die die Worte ursprünglich hinweisen. In solchen scheinbar nur semantischen Schwierigkeiten fühlt man sich immer versucht, neue Definitionen einzuführen. Aber obwohl ich dieser Versuchung kurz nachkommen werde, glaube ich nicht, dass Definitionen hier viel helfen können; es handelt sich nicht einfach um unachtsamen Sprachgebrauch. Hinter der scheinbaren Konfusion steht eine theoretische Überzeugung, derzufolge alle Unterscheidungen in der Tat von bestenfalls sekundärer Bedeutung wären, die Überzeugung nämlich, dass es in der Politik immer nur eine entscheidende Frage gäbe, die Frage: Wer herrscht über wen? Macht, Stärke, Kraft, Autorität, Gewalt - alle diese Worte bezeichnen nur die Mittel, deren Menschen sich jeweils bedienen, um über andere zu herrschen; man kann sie synonym gebrauchen, weil sie alle die gleiche Funktion haben. Erst wenn man diese verhängnisvolle Reduktion des Politischen auf den Herrschaftsbereich eliminiert, werden die ursprünglichen Gegebenheiten in dem Bereich der menschlichen Angelegenheiten in der ihnen eigentümlichen Vielfalt wieder sichtbar werden. Zugegebenermaßen sind wir versucht, Macht als eine Angelegenheit von Befehl und Gehorsam aufzufassen, und von daher Macht und Gewalt gleichzusetzen, wenn man eines der besonderen Gebiete der Macht diskutiert, nämlich die sogenannte Regierungsgewalt. Da in der Außen-, aber auch in der Innenpolitik Gewalt als letztes Mittel zum Einsatz kommt, um die Machtstruktur gegen individuelle Herausforderer - den fremden Feind, den einheimischen Verbrecher - aufrecht zu erhalten, sieht es tatsächlich so aus, als ob die Macht, die sich auf Gewalt stützt, lediglich der Samthandschuh wäre, der - je nach dem - die eiserne Hand verbirgt. Arendt kritisiert ihre Welt-Republik, die Vereinigten Staaten von Amerika The atom bomb: We invented it because we dealt with the devil and were afraid the devil would know how to make it. We used it against an ordinary enemy. We wished to keep it when there were enemies but no devils - and promptly, to justifiy this, we invented a Devil. The danger now - we become the devil. The model of all violence. Image-Pflege als Weltpolitik - nicht Welteroberung, sondern Sieg in der Schlacht "to win the people's minds" - ist allerdings etwas Neues in dem wahrlich nicht kleinen Arsenal menschlicher Torheiten, von denen die Geschichte berichtet. Und dies war nicht Sache einer der drittrangigen Nationen, die mit Prahlerei sich gern für anderes entschädigen; auch nicht eine der alten Kolonialmächte, die durch den Zweiten Weltkrieg ihre frühere Stellung eingebüsst haben und sich, wie das Frankreich De Gaulles, versucht fühlen mochten, durch Bluff ihre führende Führungsstellung zurück zu gewinnen, sondern Sache der bei Kriegsende in der Tat "führenden" Nation. Gewählte Machthaber, die den Organisatoren ihrer Wahlkampagnen so viel verdanken oder zu verdanken glauben, mögen leicht der Ansicht sein, dass man mit Manipulationen die Volksmeinung lenken und die Welt beherrschen könne. (...) Überraschend dagegen ist der Eifer, mit dem so viele "Intellektuelle" diesem phantastischen Unternehmen zu Hilfe eilten. Für Problem-Löser, die darauf spezialisiert sind, jeden Tatbestand in Zahlen und Prozente zu übersetzen und so berechenbar zu machen, ist es aber vielleicht nur natürlich, dass ihnen nie zu Bewusstsein kam, welch unsägliches Elend ihre "Lösungen" - Befriedungs- und Umsiedlungsprogramme, Entlaubung, Napalm und Bomben - für einen "Freund" bedeuteten, der "gerettet" werden musste, und für einen "Feind", der, bevor wir ihn angriffen, weder den Willen noch die Macht hatte, unser Feind zu sein. Da sie jedoch nicht an Sieg und Eroberung, sondern an die Weltmeinung dachten, ist es schon erstaunlich, dass anscheinend keiner von ihnen auf die Idee kam, die "Welt" könnte Angst vor Amerikas Freundschaft und Verpflichtungen bekommen, wenn deren ganzes Ausmaß offenkundig würde. Weder die Wirklichkeit noch der gesunde Menschenverstand scheint die Problem-Löser gestört zu haben, als sie unermüdlich ihre Szenarien für das jeweils in Frage kommende Publikum schrieben, um es psychologisch zu beeinflussen: "die Kommunisten (die unter starken Druck gesetzt werden müssen), die Südvietnamesen (deren Moral Auftrieb bekommen muss), unsere Verbündeten (die uns als "Bürgen" trauen müssen) und die amerikanische Öffentlichkeit (die den riskanten Einsatz von Prestige und Menschenleben der US unterstützen muss)." Heute wissen wir, in welchem Umfang alle diese Gruppen falsch beurteilt wurden. (...) Das größte und in der Tat fundamentale Fehlurteil bestand jedoch darin, dass man Krieg führte, um auf ein Publikum Eindruck zu machen, und dass man über militärische Fragen unter politischen und Public-Relations-Gesichtspunkten entschied (wobei "politisch" die Aussicht auf die nächste Präsidentenwahl und "Public Relations" das Image der USA in der Welt bedeuteten). Aus Hannah Arendt, 1971, Die Lüge in der Politik "Eichmann in Jerusalem": Da kann sie noch lachen! Sehen Sie, es gibt Leute, die nehmen mir eine Sache übel, und das kann ich gewissermaßen verstehen: Nämlich, dass ich da noch lachen kann. Aber ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen: Ich habe sein Polizeiverhör, 3600 Seiten, gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe; aber laut! Diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eines: Ich würde wahrscheinlich noch drei Minuten vor dem sicheren Tod lachen. 5. Dezember 1975, Arendt stirbt in New York Wir hängen nicht am Leben, das sich von selbst erschöpft, wir hängen an der Welt, für die wir ja seit eh und je das Leben zu geben bereit waren. Leseauswahl: Sebastian Hefti und Wolfgang Heuer, Hannah Arendt Denkraum, Berlin 15. Oktober 2006 |